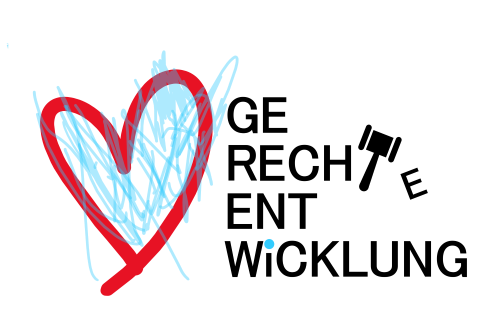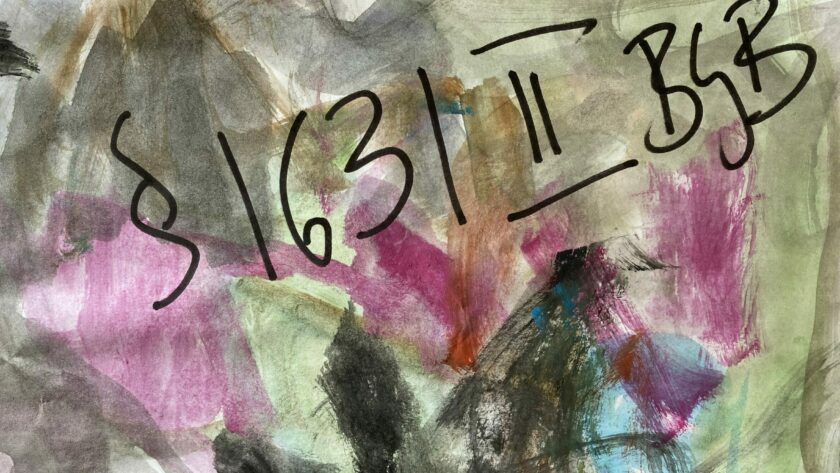„Ein Klaps auf den Po hat noch niemandem geschadet!“
Stimmt nicht, wie man heute weiß.
Eine Vielzahl an Studien macht deutlich, dass Kinder, denen Gewalt widerfährt, dadurch oft ein Leben lang belastet sind. Verhaltensauffälligkeiten, kognitive Probleme wie Konzentrationsschwierigkeiten, aber auch ein geringes Selbstwertgefühl, mangelndes Vertrauen oder psychische Störungen wie Depressionen – um nur einige Beispiele zu nennen – können Folgen von gewalttätigem Verhalten gegenüber Kindern sein. Wer hierbei in erster Linie an eine Ohrfeige oder den erwähnten Klaps auf den Po denkt, dem sei gesagt, dass nicht allein körperliche Gewalt die genannten Folgen haben kann, sondern auch psychische Gewalt in Form von Beleidigungen, Beschimpfungen, Drohungen und anderen Demütigungen. Kinder empfinden verbale Angriffe als ebenso bedrohlich wie physische.
Äußerungen wie:
„Stell dich nicht so dämlich an!“, „Er hat mal wieder seine fünf Minuten.“, „Dann gehe ich jetzt ohne dich nach Hause.“ oder „Kannst du dich nicht mal wie ein normales Kind benehmen?“,
haben das Potenzial die kindliche Seele nachhaltig zu verletzen.
Kinder müssen daher umfassend vor Gewalt geschützt werden.
Doch was regelt eigentlich der deutsche Gesetzgeber speziell im Kontext der Erziehung bezogen auf die Frage der physischen und psychischen Gewalt?
§ 1631 Abs. 2 BGB besagt: Das Kind hat ein Recht auf Pflege und Erziehung unter Ausschluss von Gewalt, körperlichen Bestrafungen, seelischen Verletzungen und anderen entwürdigenden Maßnahmen.
Diese Vorschrift hat über das Gesetz zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung in ähnlich lautender Form erstmals im Jahr 2000 Einzug in das Bürgerliche Gesetzbuch gehalten. Basis dafür war die von Deutschland ratifizierte UN-Kinderrechtskonvention, nach derer sich die Vertragsstaaten verpflichten, Kinder vor jeder Form körperlicher und geistiger Gewalt zu schützen. Zudem erfasst jedoch bereits auch der im Grundgesetz verankerte Schutz der Menschenwürde (Artikel 1 Abs. 1 GG) sowie das Recht auf körperliche Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 GG) auch Kinder. Diese können (auch) von ihren Eltern die Achtung ihrer Persönlichkeit verlangen.
Wovor schützt § 1631 Abs. 2 BGB Kinder nun konkret?
Die Rechtsprechung, die Ausführungen zum Gesetzesentwurf und die Kommentierungen zu dieser Vorschrift sagen dazu Folgendes:
Das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung umfasst das Verbot physischer und psychischer Gewalt gegen Kinder. Gewalt ist damit kein vertretbares Erziehungsmittel. Körperliche Bestrafungen stellen eine Demütigung des Kindes dar und sind ebenso verboten wie seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen; wobei diese Aufzählung nicht als abschließend zu verstehen ist.
Schläge und Ohrfeigen sind verboten. Doch auch jegliche anderen Einwirkungen auf den Körper eines Kindes, um dieses für vergangenes Verhalten zu sanktionieren sind unzulässig. Verboten sind damit auch körperliche Zwangsmaßnahmen wie das Festhalten oder Wegzerren des Kindes als Reaktion auf ein beanstandetes Verhalten. Doch wie verhält es sich, wenn das Kind beim Zähneputzen gegen seinen Willen festgehalten, der Mund zwanghaft geöffnet oder das Kind gar zu Boden gedrückt wird, damit die Eltern die Prozedur zum Schutz der Zahngesundheit ohne spürbare Gegenwehr vollziehen können? Ja, auch das ist Gewalt. Körperlicher Zwang ist Gewalt. Letztlich wird so der Unwille des Kindes, die Zähne freiwillig zu putzen oder putzen zu lassen korrigiert und sanktioniert. Kinder haben jedoch ein uneingeschränktes Recht auf eine gewaltfreie Erziehung. Es gilt ein absolutes Gewaltverbot in der Pflege und Erziehung von Kindern. Eine Einschränkung sieht weder die UN-Kinderrechtskonvention noch der Wortlaut des § 1631 Abs. 2 BGB vor. Und, ja, natürlich ist das Zähneputzen eine Notwendigkeit. Der Weg dahin mag anstrengend sein. Die nervenaufreibende Suche nach der Kooperation des Kindes rechtfertigt jedoch keinen körperlichen Zwang. Der Vollständigkeit halber sei jedoch erwähnt, dass Eltern selbstverständlich nicht daran gehindert werden, ihr Kind an einer roten Ampel zurückziehen, um es davor zu bewahren, vor ein Auto zu laufen.
Seelische Verletzungen sind gleichermaßen unzulässig. Hierbei ist darauf abzustellen, ob das Kind sich durch das Verhalten der Eltern tatsächlich getroffen fühlt. Demütigende, bloßstellende Maßnahmen (etwa vor Freunden), kränkende oder herabsetzende Äußerungen, Beschimpfungen, permanente Kritik und ein liebloser oder kalter Umgang fallen unter diesen Begriff. Konkret erfasst sind damit beispielsweise auch öffentliche Hinweise auf Verfehlungen des Kindes, andauerndes Nichtsprechen mit dem Kind und das Einsperren im Dunkeln. Doch auch der Ausschluss des Kindes von gemeinsamen Aktivitäten, das Ignorieren oder Isolieren im Zimmer können ein Kind seelisch verletzen.
Ausdrücklich verboten sind darüber hinaus schließlich alle entwürdigenden Maßnahmen; also solche, die das Selbstbewusstsein des Kindes oder dessen Ehrgefühl gefährden oder verletzen können. Mit dieser Formulierung werden auch jene Handlungen für unzulässig erklärt, die das Kind selbst nicht als verletzend wahrnimmt oder von denen das Kind nichts mitbekommt, weil es beispielsweise seitens der Eltern gegenüber Dritten hinter seinem Rücken verächtlich gemacht oder herabgesetzt wird.
Und nun, was kann das bloßgestellte oder gedemütigte Kind tun?
Ziel des § 1631 Abs. 2 BGB ist nicht die Kriminalisierung der Familie. Der Fokus liegt nicht auf der Strafverfolgung oder dem Entzug des Sorgerechts. Das Kind hat auch keinen einklagbaren Anspruch auf Unterlassung verletzender Äußerungen. Die Vorschrift bezweckt vielmehr die Herbeiführung einer Bewusstseinsänderung seitens der Bevölkerung und der Eltern. Eine Bewusstseinsänderung, die die Erziehung nicht nur von körperlicher Gewalt befreit, sondern die Kindern eine liebevolle Kindheit, ohne Beleidigungen, Angst machen, Anbrüllen oder andere seelische Verletzungen und entwürdigende Maßnahmen ermöglicht.