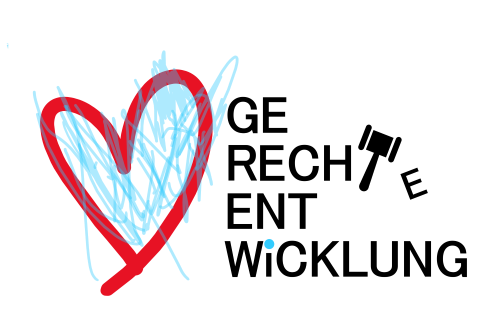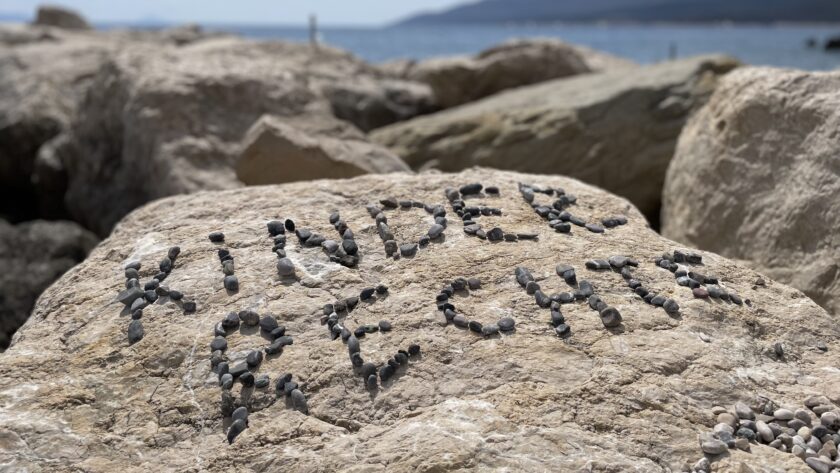Kinder sind Menschen. Die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 statuierten Rechte gelten daher ebenso wie jene anderer Menschenrechtsübereinkommen auch für Kinder. Kinder haben jedoch spezielle, mit ihrer Entwicklung zusammenhängende Bedürfnisse, die sie von Erwachsenen unterscheiden. Dem trägt die von den Vereinten Nationen im Jahre 1989 verabschiedete UN-Kinderrechtskonvention (KRK) Rechnung. Sie ergänzt und konkretisiert die allgemeinen Menschenrechte.
Die KRK basiert auf der Anschauung, dass Kinder nicht lediglich Objekte oder kleine Erwachsene sind, für die Entscheidungen zu treffen sind. Vielmehr betrachtet die KRK Kinder als Individuen in einer vom Erwachsensein losgelösten, besonderen Phase, denen eigene Rechte zuteilwerden. Die in der KRK verankerten Rechte umfassen ein weites Spektrum und lassen sich einerseits nach wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, bürgerlichen und politischen Rechten und andererseits nach Schutz-, Förder- und Beteiligungsrechten unterscheiden. Vier wesentliche Prinzipien liegen der KRK zugrunde: das Diskriminierungsverbot (Art. 2), der Vorrang des Kindeswohls (Art. 3), das Recht auf Leben und Entwicklung (Art. 6) und das Recht auf Beteiligung (Art. 12).
Die KRK trat 1992 in Deutschland in Form eines Bundesgesetzes in Kraft; wobei die Ratifizierung zunächst unter einem Vorbehalt erfolgte, den die Bundesrepublik erst im Jahre 2010 zurücknahm. Das Grundgesetz lässt eine Verankerung von Kinderrechten bisher vermissen. Seit Inkrafttreten der KRK sind die in ihr verbrieften Kinderrechte jedoch vielfach in nationale Gesetze eingeflossen. Zu nennen ist hier beispielhaft das Gesetz zur Ächtung der Gewalt in der Familie, welches im November 2000 verabschiedete wurde. Damit fand das Recht von Kindern auf eine gewaltfreie Erziehung Einzug in das Bürgerliche Gesetzbuch.