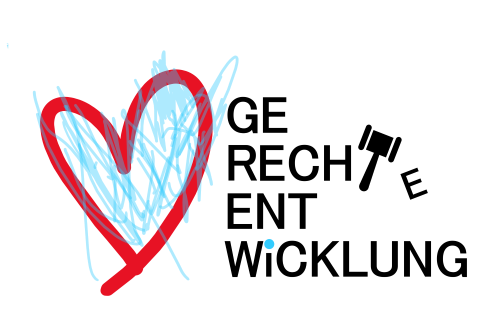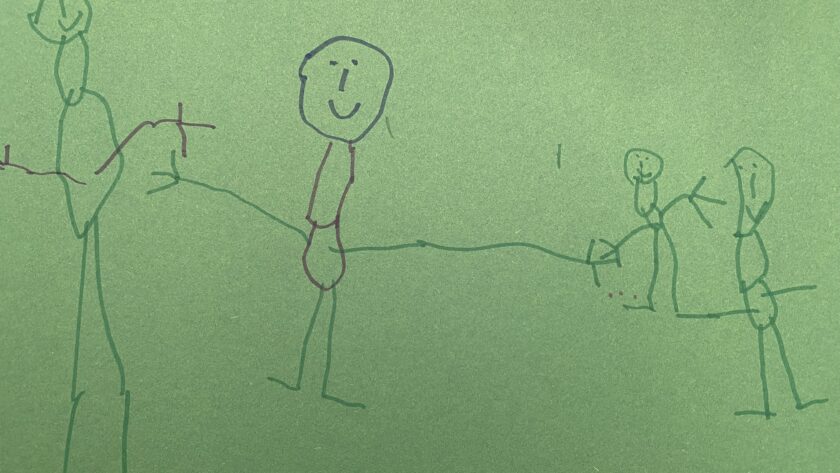Bindung beschreibt eine enge, überdauernde emotionale Beziehung zwischen zwei Menschen.
Menschen werden unreif geboren. Nur durch den Schutz und die Unterstützung einer anderen Person können sie ihr Überleben sichern und sich optimal entwickeln. Bowlbys Bindungstheorie folgend verfügen Menschen zu diesem Zwecke über ein angeborenes Bindungssystem, welches bereits Säuglinge und Kleinkinder dazu veranlasst, in bestimmten, für sie belastenden Situationen (wie einer tatsächlichen oder angenommenen Gefahr, Schmerz, Angst oder Krankheit) die Nähe zu einer ihnen vertrauten Person zu suchen. Um diese Nähe zu erhalten, bedienen sich Kinder – abhängig vom Alter – einer Vielzahl an Bindungsverhaltensweisen. Säuglinge weinen oder schreien, Kleinkinder klammern sich an, laufen nach oder protestieren verbal zum Zwecke des Herstellens oder Aufrechterhaltens von Nähe. Reagiert die Bindungsfigur bzw. Bezugsperson zuverlässig, zügig und angemessen auf das gezeigte Verhalten kann sich das gestresste Kind beruhigen und es entsteht ein Gefühl der Sicherheit.
Die konkreten Abfolgen von Bindungsverhalten und der Reaktion der Bezugsperson auf dieses Verhalten werden im Gehirn – wenn auch nicht unbedingt bewusst – gespeichert. Über die Zeit konstruiert der Mensch ein sogenanntes internales Arbeitsmodell. Dieses beinhaltet alle bindungsbezogenen Erfahrungen, die eine Person in ihrem Leben gemacht hat. Damit einher gehen unter anderem auch Annahmen über das zu erwartende Verhalten der Bindungsfigur, d.h. ob das Kind auf Schutz und Hilfe vertrauen kann oder nicht. Dies beeinflusst wiederum die Qualität der Bindung. Die dort gespeicherten Erfahrungen haben darüber hinaus Auswirkungen auf andere zwischenmenschliche Beziehungen, das Selbstwertgefühl und den Umgang mit Emotionen.
Idealerweise erfährt das Kind seine Bezugsperson als ansprechbar, zuverlässig und feinfühlig. Feinfühlig meint, dass die Bindungsperson nicht nur auf die Signale des Kindes reagiert, sondern diese auch richtig zu deuten weiß. Derartige positive Erfahrungen tragen in ihrer Gesamtheit sodann zu einer sicheren Bindung bei. Ob ein Kind sicher oder unsicher gebunden ist, hängt also in erster Linie von den Erfahrungen ab, die es mit seinen Bezugspersonen macht.
Vorteile einer sicheren Bindung
Sicher gebundene Kinder vertrauen darauf, dass ihre Bezugsperson bei Bedarf verfügbar ist und angemessen reagiert. Eine zuverlässige Bindungsfigur fungiert als Basis, von der aus ein Kind die Welt entdecken kann.
Die sichere Bindung ist mit einer Vielzahl positiver Eigenschaften assoziiert. Sicher gebundene Kinder haben im Vergleich zu unsicher gebundenen Kindern ein höheres Selbstwertgefühl, sind widerstandsfähiger bei Belastungen und können besser mit Stress umgehen. Sie sind zudem empathischer, sozial kompetenter, zufriedener und haben weniger häufig mit psychischen Problemen zu kämpfen; um nur einige Vorteile zu nennen. Etwa zwei Drittel aller Kinder auf der Welt über verschiedene Kulturen und gesellschaftliche Schichten hinweg sind sicher gebunden. Ein Drittel ist es hingegen nicht. Dabei gilt, dass alle Menschen sichere und unsichere Bindungserfahrungen machen. Entscheidend für das Entstehen einer sicheren oder unsicheren Bindung bei Kindern ist insbesondere, wie das Kind seine Bindungsperson auf einer regelmäßigen Basis erlebt.
Die Bedeutung der Bindungstheorie im Alltag
Im Alltag bedeuten die Erkenntnisse der Bindungstheorie beispielsweise, dass es keine gute Idee ist, ein Kind im Bett schreien zu lassen; auch nicht „nur“ ein paar Minuten. Die Dunkelheit stellt für ein Kind eine potenziell bedrohliche Situation dar, die das Bindungssystem aktiviert. Ohne die Nähe einer erwachsenen Person wäre das Kind vor noch gar nicht allzu langer Zeit schutzlos wilden Tieren, dem Erfrieren oder sonstigen tatsächlichen Gefahren ausgesetzt gewesen. Dass es das im sicheren Zimmer nicht ist, weiß es nicht. Also schreit es, um sich Hilfe zu holen. Bekommt es die gewollte Unterstützung wird dies als eine positive Bindungserfahrung im Gehirn abgespeichert und das Kind fühlt sich sicher. Erhält es diese nicht, wird es seine Bemühungen intensivieren und weiter schreien; in der Hoffnung, dass doch noch jemand reagiert. Passiert weiterhin nichts, wird es die Anstrengungen mangels Aussicht auf Erfolg irgendwann einstellen. Das Kind ist ruhig; wenn auch weiterhin gestresst. Diese negativen Interaktionserfahrungen werden ebenfalls gespeichert – mit den oben aufgezeigten, denkbaren Konsequenzen.
Auch noch unbekannte Situationen mit neuen Menschen in einer neuen Umgebung vermögen in einem Kind Angst auszulösen und das Bindungssystem zu aktivieren. Beispielhaft dafür ist insbesondere die Anfangszeit in einer Kindertagesstätte oder aber auch der erstmalige Besuch einer solchen nach einer längeren Abwesenheit. Ein mit Blick auf die neue Gesamtsituation verunsichertes, schreiendes und weinendes Kind sollte in diesem Zustand nicht allein dort zurückgelassen werden. Es braucht eine vertraute Person, die ihm Nähe und Schutz und damit ein Gefühl der Sicherheit gewährt, sonst wird es die Angst nicht los. An spielen und damit einhergehend auch lernen ist in einem Zustand der Angst und/oder Unsicherheit nicht zu denken. Ein sicheres Gefühl können zwar grundsätzlich auch die Betreuenden in der Einrichtung vermitteln, dafür benötigt das Kind allerdings erst einmal eine Bindungsbeziehung zu den Mitarbeitenden. Der Aufbau einer solchen braucht in der Regel jedoch Zeit. Eine auf die Bedürfnisse des Kindes individuell ausgerichtete Eingewöhnung im Beisein einer dem Kind bekannten und vertrauten Person ist im Sinne einer sicheren Bindung (auch bezogen auf die Eltern) und all den damit einhergehenden Vorteilen daher von essenzieller Bedeutung. Zwar mag es mit Blick auf ihre ausgeprägte Anpassungsfähigkeit sein, dass auch Kinder, die nach ihren Eltern schreiend in der Kita zurückgelassen werden, irgendwann in der Kita „ankommen“ und nicht mehr weinen. Die negativen Bindungserfahrungen, die das Kind in diesen Situationen gemacht hat, haben dennoch ihre Spuren im Gehirn hinterlassen und können die (psychische) Entwicklung negativ beeinflussen.